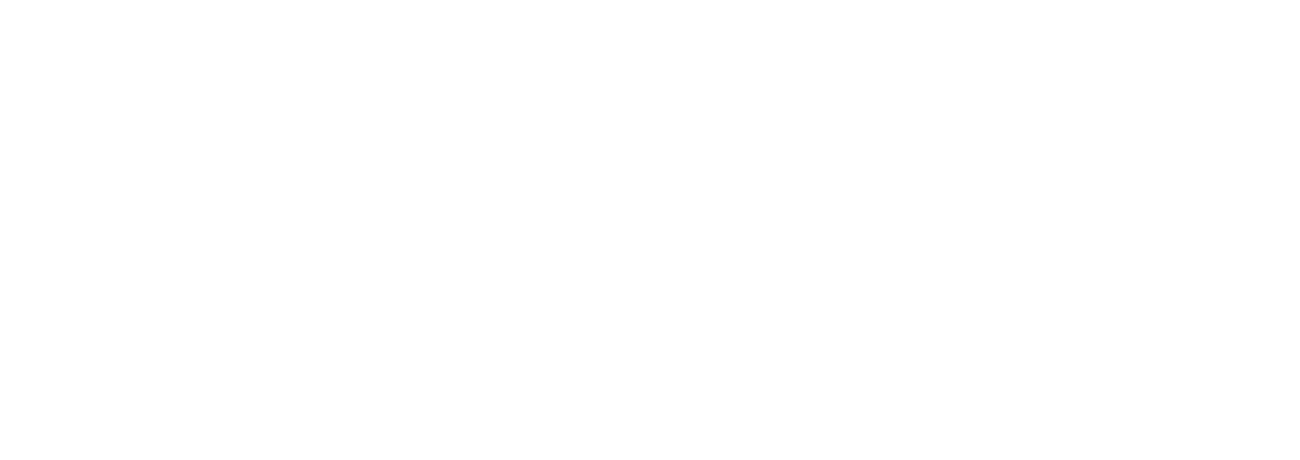Extraterrestrische Intelligenz(en) – wie divers ist E.T.?
Heute geht es um einen Artikel von John W. Traphagan mit dem Titel “Culture and Communication with Extraterrestrial Intelligence” in: Vakoch, Douglas A., Archaeology, Anthropology and Interstellar Communication, NASA History Series NASA SP-2013-4413, pp. 79-94. (Download hier: https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Archaeology_Anthropology_and_Interstellar_Communication_TAGGED.pdf).
Traphagan stell dar, auf welche Weise bisher versucht wurde, interstellare Botschaften zu entwickeln: mit Hilfe der Mathematik, deren Regeln als universell gelten und mit Hilfe der Musik. Aber auch über die Bereiche “Ästhetik” sowie “Spiritualität” wurde bereits der Versuch unternommen, ein Konzept zu entwickeln mit dessen Hilfe man potentiellen E.T.-Kontakten “Hallo” sagen könne.
Auf welche Art auch immer wir mit einer intelligenten Spezies außerhalb der Erde kommunizieren würden – alle wissenschaftlichen Bemühungen laufen stets darauf hinaus, eine universelle Sprache zu finden, die nicht nur als Botschaft wahrgenommen, sondern auch verstanden, also übersetzt werden könne.
In diesem Zusammenhang erörtert Traphagan die Definitionen von Intelligenz. Er verweist dabei auf Marvin Minsky (Link), der Intelligenz mit
Selbstbewusstsein, Problemlösungsfähigkeit, analytische Fähigkeiten, die Fähigkeit, die Welt zu beschreiben, Phänomene zu erklären, Informationen zu sammeln und auszutauschen, knappe Ressourcen zu verteilen und vorausschauend zu planen.
Nun, das sind ziemlich viele Voraussetzungen, um auf Wesen zu treffen, die mindestens den selben IQ wie wir haben sollten, oder? Traphagan setzt noch einen drauf und sagt (sinngemäß): Um all das überhaupt zu ermöglichen, braucht es einer Kultur. Und diese sei nicht universell, sondern variabel.
Hierauf folgt eine spannende Auseinandersetzung mit dem Begriff “Kultur”. Demzufolge sei nach James L. Watson der Begriff “Kultur” etwas, was eine Gruppe von Menschen durch gemeinsame Glaubenssätze, Werte und Verhalten vereint. Richtigerweise zweifelt Traphagan dies an, denn Kultur als solche kann auch entzweien, nämlich dann, wenn Menschen sich aus Opportunitätsgründen oder anderen Gründen heraus auf ein bestimmtes Verhalten geeinigt haben, das einzelne Individuum, aber so etwas nicht aus eigenem Antrieb heraus tun würde.
Darüber hinaus sage auch die Mitgliedschaft in einer Kultur nichts darüber aus, welche subjektiven Erfahrungen und Erinnerungen das einzelne Individuum damit verbinde. Ein schönes Beispiel ist die kollektive Liebe vieler Amerikaner zum Baseball. Während vielleicht eine Ehefrau diesen Sport mit ihrem ständig auf der Couch vor dem TV sitzenden Ehemann verbindet, wird eine unverheiratete Frau diese Erfahrung vermutlich nicht haben.
Hieraus ergibt sich eine sehr wichtige Erkenntnis:
Die Selbstwahrnehmung eines Menschen als Teil einer Kultur sei dementsprechend stets eng mit dem verknüpft, was er für wichtig hält und worauf er sich konzentriert. Glaubenssätze würden ständig herausgefordert und weiterentwickelt.
Wir könnten also nicht von der einen Kultur sprechen, da es diese nicht gäbe. Kultur sei also ein sich ständig verändernder Prozess in einem fixierten Framework.
Ganz so radikal würde ich dies nicht sehen. Wir sprechen in der Ägyptologie gemeinhin stets von der “Altägyptischen Kultur”. Richtigerweise sind wir vom Begriff der “Hochkultur” abgerückt, da dieser das Risiko birgt, die eine Kultur der anderen gegenüber als superior zu beschreiben. Aber niemand würde daran zweifeln, dass die Alten Ägypter eine einzigartige Gruppe von Menschen war, die über eine für sie charakteristische Ikonografie und Mythologie verfügte, die sie deutlich abgrenzbar zum Beispiel gegenüber der assyrischen Kultur machte. In einer Fußnote (fn. 14, p. 167) stellt Traphagan noch einmal klar, dass es wichtig ist, eine Kultur nicht als “die da draußen” zu bezeichnen, um damit Unterschiede im Sinne von Rassen und Ethnizität zu zementieren.
Das ist absolut richtig. Aber die Einordnung in “Kulturen”, sollte ähnlich wie wissenschaftliche Kategorisierungen und Klassifizierungen erfolgen. Es sind Werkzeuge, die uns ermöglichen, die Unterschiede überhaupt erst wahrzunehmen. Sie dienen der Beschreibung, dem Vergleich und der Sichtbarmachung von Andersartigkeiten. Sie sollten immer mit dem Ziel der Selbstreflexion erfolgen, niemals dazu benutzt werden Rassenideologien oder andere unethische Maßnahmen zu rechtfertigen. Nur unter diese Prämisse ist ein wissenschaftliche Diskurs überhaupt möglich.
Dieses Prinzip kann man mit dem Blick eines Kleinkindes in den Spiegel vergleichen. Ein Baby, das sich noch voll mit der eigenen Mutter identifiziert, nimmt das Gegenüber im Spiegel zunächst gar nicht wahr. Später sieht es eine fremde Person und ist – je nach eigener Laune – gut auf sein Spiegelbild zu sprechen oder nicht. Erst als heranwachsendes Kind, das sich nach und nach als von der Mutter getrenntes Individuum erfährt, erkennt es sich selbst im Spiegel.
Ein weiterer spannender Punkt, den Traphagan anspricht, ist die Abhängigkeit von Kultur und biologischen Voraussetzungen. Die Frage also, wie die Welt wahrgenommen wird, hängt auch davon ab, mit welchen Sinnen diese Wahrnehmung erfolgt. Dabei verweist er auf einen interessanten Vergleich: Während wir Menschen die Distanz zu festen Objekten und ihre Begrenzung mit Hilfe unserer Augen optisch wahrnehmen, tun Fledermäuse dies mit Hilfe von Echolokation. Sie senden also akustische Signale aus, nehmen deren Reflexionen wahr und “übersetzen” sie in die Information, dass sich dort eine Felswand und hier ein Baum befindet. Das, so Traphagan, sei für uns nicht möglich, da wir nicht über einen solchen Wahrnehmungsapparat verfügten.
In diesem Zusammenhang sei einmal darauf hingewiesen, dass die menschliche Spezies in Extremsituationen durchaus in der Lage ist, den eigenen Wahrnehmungsapparat so zu formen, dass beispielsweise trotz einer Sehbehinderung der Alltag für den Betroffenen dennoch gut zu meistern ist. In besonderen, bislang noch nicht vollständig erforschten Ausnahmefällen, entwickeln Blinde sogar Fähigkeiten, die der Echolokation von Fledermäusen ähnlich ist, siehe das Ben Underwood Miracle: https://www.youtube.com/watch?v=fnH7AIwhpik .
Eine wesentliche Schlussfolgerung Traphagans ist eine, die ich persönlich mittrage: Wir werden es bei einer extraterrestrischen Zivilisation vermutlich ebenfalls nicht mit einer vollständig homogenen Gruppe von Wesen zu tun haben.
Vielleicht sollten wir uns aber von dem starren Begriff “Kultur” lösen und das Phänomen hingegen “kulturelle Ausprägungen” nennen, die unsere facettenreiche Spezies abbilden.
Allerdings kommen wir hier wieder an den Punkt, den ich oben bei der Kategorisierung von Menschengruppen angesprochen habe: Wir sprechen von uns als “Menschen”. Menschenähnliche Wesen wären dann vielleicht die “Humanoiden” oder die “Marsianer”, oder wie auch immer man die fremde Spezies nennen mag. Aber es bleiben Kategorisierungen, egal, ob man hinein oder heraus zoomt. Diese sollen uns helfen, die Unterschiede wahrzunehmen, den Kontrast zu erkennen, damit wir feststellen können, dass es da draußen noch etwas anderes gibt als uns. Sie sollten keine Trennung, keine Aggression gegen das Unbekannte erzeugen und uns schon gar nicht daran hindern, E.T. freundlich die Hand zu reichen.